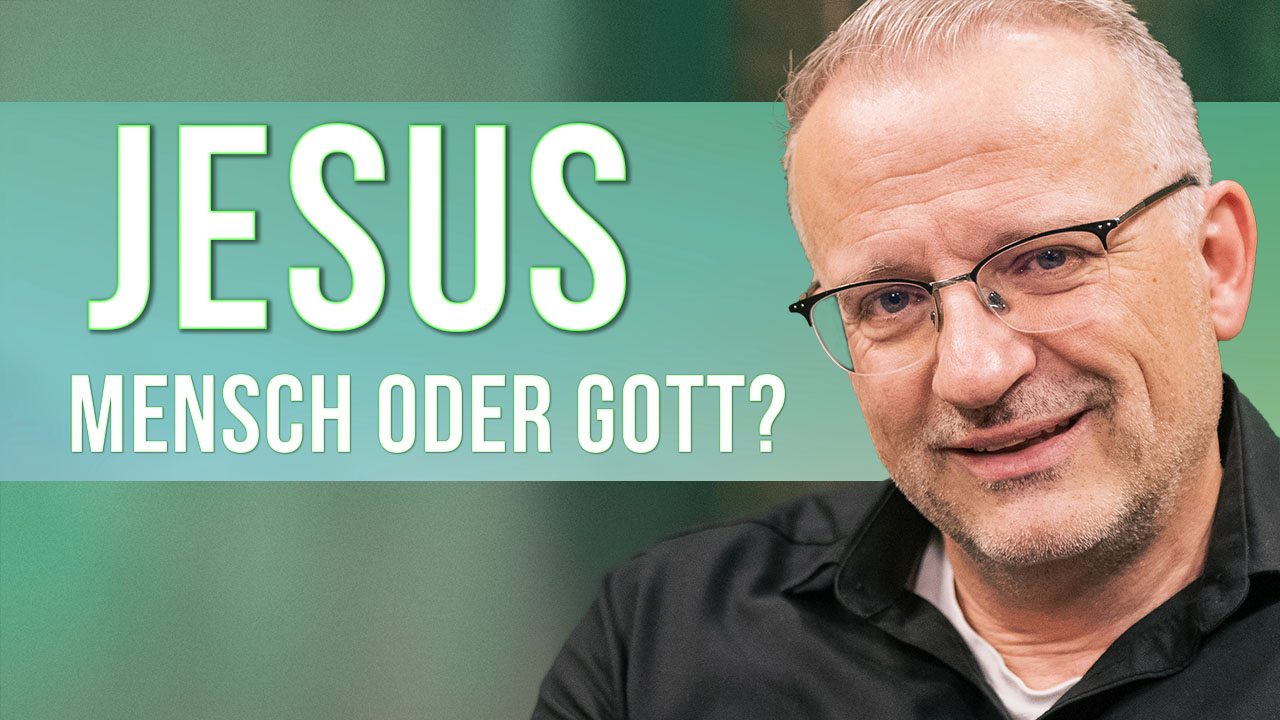Thomas Bänziger, Pfr. Dr. theol., Stiftung Schleife
Was hat das Lamm mit Ostern zu tun?
In meiner Kindheit stand an Ostern ein Butterlamm auf dem Frühstückstisch. Bei anderen gibt es zum Osterkaffee ein süsses aus Rührteig gebackenes Lämmchen. In Schaufenstern finden wir in diesen Tagen das Lamm als beliebten Oster-Dekoartikel. Umgangssprachlich kennen wir die Rede vom «Osterlamm». Die ursprüngliche Bedeutung davon ist wesentlich tiefer als ein Biskuitgebäck oder ein Deko-Accessoire, auch wenn Google uns zu diesem Stichwort vor allem Bilder dazu liefert. Jesus selbst, um den es an Ostern primär geht, wird im Johannesevangelium als das «Lamm Gottes» bezeichnet. Um herauszufinden, weshalb Jesus das «Osterlamm» ist, müssen wir etwas in der Bibel blättern.
Abraham und das Lamm
In 1. Mose 22 wird Abraham von Gott auf die Probe gestellt: Er soll seinen Sohn Isaak auf dem Berg Morija (Jerusalem) opfern. Gehorsam macht sich der Vater des Glaubens auf den Weg. Am dritten Tag seiner Reise befindet er sich zusammen mit seinem Sohn auf dem Aufstieg zum Berg. «Wir haben Feuer und Holz, aber wo ist das Lamm zum Brandopfer?», fragt Isaak. «Gott wird sich ein Lamm zum Brandopfer ausersehen», antwortet Abraham. In letzter Sekunde interveniert Gott: Abraham muss seinen Sohn nicht umbringen, sein Vertrauen hat sich bewährt, Gott hat sich ein Lamm ausersehen. An Isaaks Stelle wird ein Widder geopfert, der sich mit seinen Hörnern im naheliegenden Gestrüpp verfangen hatte. Wo bleibt nun aber das angekündigte Lamm?
Das Passahlamm
Die Frage wird erst im zweiten Buch Mose beantwortet. Die Israeliten leben als Sklaven in Ägypten. Zehn Plagen sind notwendig, um den Pharao zum Einlenken zu bewegen, das Sklavenvolk ziehen zu lassen. Die zehnte Plage hat es in sich: Alle männliche Erstgeburt der Ägypter stirbt. Damit Israel dem Todesengel entkommt, gibt Gott seinem Volk konkrete Anweisungen (siehe 2. Mose 12): Vom 10. bis zum 14. Tag des ersten Monats muss ein Lamm ins Haus jeder Familie genommen werden. Danach wird es geschlachtet und das Blut des Lammes an die Türpfosten und die Schwellen angebracht. Das Blut an den Häusern ist das Schutzzeichen, damit das Verderben vorbeizieht (hebräisch pasach). Das Lamm selber wird in dieser Nacht gebraten und zusammen mit ungesäuertem Brot und bitteren Kräutern gegessen. Das ganze Lamm muss verzehrt und es darf ihm kein Knochen gebrochen werden.
An Pessach (oder Passah) erinnert sich das jüdische Volk bis heute an den Auszug aus Ägypten und an das Vorbeiziehen des Todes aufgrund des Blutes des Lammes. Heute noch erinnert der Lammknochen am Sederabend beim Passahfest, dass damals das Lamm anstelle der Erstgeburt starb.
Das stumme Lamm
Wir blättern im Alten Testament noch etwas weiter: Der Prophet Jesaja darf einen Blick auf den kommenden Messias werfen. Jahrhunderte vor der Geburt Jesu schreibt er (Jesaja 53,5-7): «Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der HERR warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird; und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf.»
Auch hier treffen wir auf das Motiv des Schafes: Nicht nur wir Menschen werden mit Schafen verglichen, die immer wieder vom Weg abkommen, sondern der Messias wird als Opferlamm beschrieben. Der Messias wird an unserer Stelle sterben, unsere Schuld auf sich nehmen. Wie das Passahlamm gibt er sein Leben für den Frieden und die Heilung der Menschen. Im stummen Opferlamm malt uns Jesaja ein eindrückliches Bild für den kommenden Retter vor Augen.
Jesu Geburt und Taufe
Nun sind wir im Neuen Testament angelangt. Bei der Geburt Jesu weideten Hirten auf den Feldern rings um Bethlehem ihre Herden (siehe Lukas 2). Im Umkreis von Jerusalem wurden damals Schafe für die Opfer im Tempel gehalten. Gut möglich, dass die Hirten an der Krippe Jesu keine gewöhnlichen Schafe züchteten, sondern Opfertiere – unter anderem auch die Passahlämmer. Schon bei der Geburt Jesu schwingt also das Lamm mit, explizit wird es bei der Taufe.
Als Jesus auf Johannes den Täufer zugeht, um sich von ihm taufen zu lassen, prophezeit dieser über ihm (Johannes 1,29): «Seht, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt.» Den Menschen damals ist die Rede vom Opferlamm aufgrund der täglichen Opfer im Tempel und wegen Pessach sehr präsent. Wie das Passahlamm gute drei Tage bei der jüdischen Familie im Haus war, so lebt Jesus in der Folge dreieinhalb Jahre mit seinen Jüngern. Die Menschen lernten ihn kennen und lieben. Aber sie müssen sich schmerzhaft von ihm trennen, wie die Familien damals von ihrem Lämmchen am ersten Pessach.